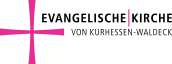Archivprojekt Digitalisierung Baupläne
12. März 2024
Im Landeskirchlichen Archiv lagern Baupläne von rund 1.000 Gebäuden (Kirchen, Pfarrhäuser, Gemeindehäuser, Kindergärten, Jugendheime). Wenn wir bei jedem Objekt von 50 Bauplänen ausgehen, von Kleinformaten bis zu DIN A0, kommen wir auf 50.000 Pläne, die in Einzelblattverzeichnung für die Digitalisierung vorzubereiten sind.
Ende 2022 konnten zur Vorbereitung des Projekts, das uns voraussichtlich die kommenden Jahrzehnte beschäftigen wird, zusätzliche DIN A0 Plan-Schränke angeschafft. 2023 haben Peter Heidtmann-Unglaube und Thomas Gothe probeweise rund 900 Baupläne verzeichnet und mit einem sprechenden Dateinamen versehen. Anschließend wurden die Pläne in das Digitalisierungszentrum des LVR gebracht (Abtei Pulheim). Von 2010 bis 2020 wurden dort bereits die Kirchenbücher der Landeskirche digitalisiert.
Seit Oktober 2023 bereitet Helena Neumann die Baupläne für die Digitalisierung in größerem Umfang vor. Dabei können kleinere Formate bis DIN A3 bei uns im Archiv selbst mit dem Bookeye Scanner, der von der Landeskirchlichen Bibliothek übernommen werden konnte, digitalisiert werden. Die größeren Formate bis DIN A0 werden in Portionen von je 2.000 Plänen in das Digitalisierungszentrum transportiert (ein- bis zweimal pro Jahr).
Anders als die digitalisierten Kirchenbücher, die weitgehend im Kirchenbuchportal www.archion.de für jedermann einsehbar sind, werden die digitalisierten Baupläne intern von großem Nutzen sein.